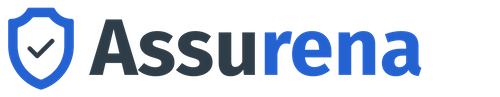Berufsunfähigkeit aufgrund einer Alkoholsucht

tell dir vor, Anna, 42 Jahre alt, arbeitet seit vielen Jahren als erfolgreiche Steuerfachangestellte. Sie liebt ihren Beruf, auch wenn der Job oft stressig ist: lange Arbeitszeiten, hohe Verantwortung, ständiger Termindruck. Um abends „runterzukommen“, greift sie irgendwann regelmäßig zum Glas Wein – erst ein Glas, dann zwei, später eine Flasche.
Nach einigen Jahren merkt Anna, dass sie ohne Alkohol kaum noch entspannen oder schlafen kann. Die Arbeit fällt ihr zunehmend schwer: Sie ist unkonzentriert, macht Fehler, vergisst Termine. Schließlich wird bei ihr eine Alkoholerkrankung diagnostiziert. Anna schafft es zwar, eine Entzugstherapie zu beginnen, doch sie ist nicht mehr in der Lage, ihre Arbeit wie früher auszuüben.
Genau an diesem Punkt stellt sich die Frage: Kann sie Leistungen aus ihrer Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) bekommen?
Was die Berufsunfähigkeitsversicherung verlangt
Die Regeln sind klar: Berufsunfähigkeit liegt dann vor, wenn jemand seinen zuletzt ausgeübten Beruf aus gesundheitlichen Gründen mindestens zu 50 % für voraussichtlich sechs Monate oder länger nicht mehr ausüben kann.
Das bedeutet: Es zählt nicht, ob Anna theoretisch noch irgendeine Arbeit machen könnte – sondern ob sie ihren Job als Steuerfachangestellte noch schafft.
Alkoholsucht als Krankheit
Oft gibt es Vorurteile, dass Alkoholabhängigkeit eine „Schwäche“ sei. Doch das stimmt nicht: Schon 1968 hat das Bundessozialgericht entschieden, dass Alkoholsucht eine Krankheit ist. Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) führt sie in der internationalen Klassifikation von Krankheiten (ICD-10, Code F10) als „psychische und Verhaltensstörung durch Alkohol“.
Und wie bei jeder anderen Krankheit auch kann Alkoholsucht so schwer werden, dass man seinen Beruf nicht mehr ausüben kann – etwa durch:
Konzentrationsprobleme
körperliche Schäden (z. B. Leber, Nervensystem)
psychische Begleiterkrankungen (z. B. Depression, Angststörungen)
Wo es für Versicherte schwierig wird
Viele Versicherte wie Anna stoßen aber auf Stolperfallen:
- Vorvertragliche Anzeigepflicht
Beim Abschluss der Versicherung muss man alle bekannten Vorerkrankungen angeben. Wer frühere Entzugsbehandlungen, Klinikaufenthalte oder psychotherapeutische Sitzungen verschweigt, riskiert im Ernstfall den Verlust des Versicherungsschutzes. Selbst wenn die spätere Berufsunfähigkeit gar nichts mit der Sucht zu tun hat, kann der Versicherer den Vertrag kündigen oder anfechten. - Vorsatz-Argument der Versicherer
Manchmal behaupten Versicherer: „Der Versicherte hat seine Berufsunfähigkeit selbst verschuldet, weil er ja freiwillig getrunken hat.“ Doch hier urteilen Gerichte oft zugunsten der Betroffenen. Denn im Laufe einer Suchterkrankung verliert man die Kontrolle über den Konsum – und damit fehlt der bewusste Vorsatz, sich absichtlich berufsunfähig zu machen. - Nachweispflicht
Der Betroffene muss medizinisch belegen, dass er durch die Erkrankung tatsächlich zu mindestens 50 % eingeschränkt ist. Dazu gehören Arztberichte, Therapienachweise und eine genaue Schilderung, warum die letzte Tätigkeit nicht mehr ausgeübt werden kann.
Fazit – Annas Weg
Für Anna bedeutet das: Sie muss ihre Einschränkungen klar dokumentieren und mit ärztlichen Befunden belegen. Nur so kann sie nachweisen, dass ihre Alkoholerkrankung zur Berufsunfähigkeit geführt hat.
Der Weg ist oft lang und anstrengend, manchmal voller Auseinandersetzungen mit der Versicherung. Aber: Alkoholsucht kann genauso wie andere schwere Krankheiten zur Berufsunfähigkeit führen. Wer ehrlich bei den Gesundheitsfragen war und seine Situation gut belegt, hat eine realistische Chance auf Leistungen.